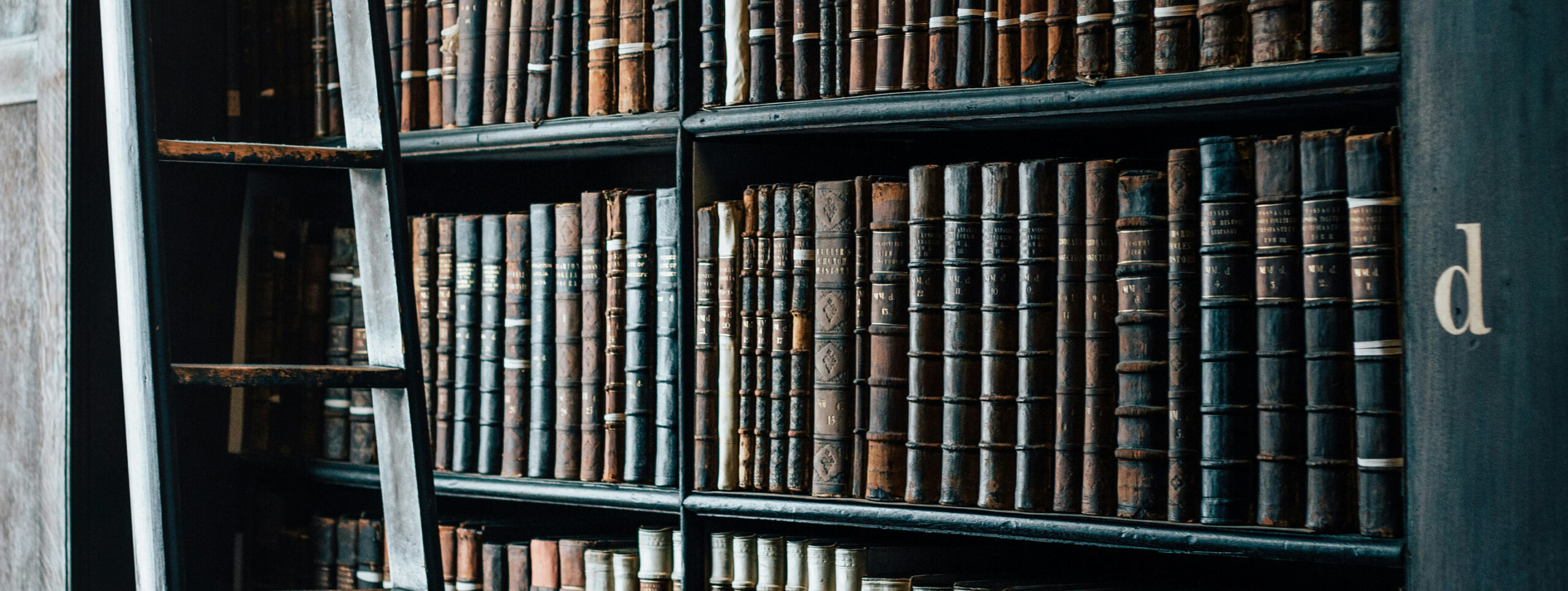Monat: Mai 2013
-
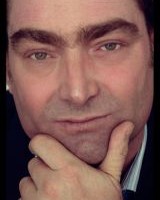
Der Vertrag des Softwareerstellers
Weiterlesen: Der Vertrag des SoftwareerstellersVerträge mit freien IT-Mitarbeitern sind in der Regel entweder Dienst- oder Werkverträge. In der Praxis erweist es sich häufig als schwierig, beide Verträge voneinander abzugrenzen. Indizien für das Vorliegen eines Werkvertrages sind nach ständiger Rechtsprechung des BGH, wenn die Parteien die zu erledigende Aufgabe und den Umfang der Arbeiten konkret festlegen oder eine erfolgsabhängige Vergütung…
-
Höffner darf sich nicht „Bestes Möbelhaus“ nennen
Weiterlesen: Höffner darf sich nicht „Bestes Möbelhaus“ nennenDas Möbelhaus Höffner hat auf seiner Internetseite mit einem Testergebnis geworben. Getestet hatte das “Deutsche Institut für Service-Qualität“ und das Ergebnis für Möbelhöffner war: 1. Platz, Bestes Möbelhaus. Angegeben wurde außerdem: „Test 08-2009 – im Vergleich: 14 Unternehmen – www.disq.de – DISQ GmbH und Co. KG”. Den Test hatte die DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität…
-
Bundesgerichtshof legt dem Gerichtshof der Europäischen Union Frage zur urheberrechtlichen Zulässigkeit des „Framing“ vor
Weiterlesen: Bundesgerichtshof legt dem Gerichtshof der Europäischen Union Frage zur urheberrechtlichen Zulässigkeit des „Framing“ vorDer u.a. für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage vorgelegt, ob der Betreiber einer Internetseite eine Urheberrechtsverletzung begeht, wenn er urheberrechtlich geschützte Inhalte, die auf anderen Internetseiten öffentlich zugänglich sind, im Wege des „Framing“ in seine eigene Internetseite einbindet. Die Klägerin, die Wasserfiltersysteme herstellt und vertreibt, ließ…
-
Scheingeschäftsführer haftet für Steuerschulden der GmbH
Weiterlesen: Scheingeschäftsführer haftet für Steuerschulden der GmbHDer Bundesfinanzhof hat entschieden (BFH, 11.03.2004 – VII R 52/02), dass auch ein Scheingeschäftsführer für die Steuerschulden einer GmbH haftet. Die Haftung ergebe sich schon aus der nominellen Bestellung zum Geschäftsführer und ohne Rücksicht darauf, ob die Geschäftsführung auch tatsächlich ausgeübt werden kann und ob sie ausgeübt werden soll. Der GmbH-Geschäftsführer könne sich nicht damit entschuldigen,…
-
Bundesgerichtshof entscheidet über fristlose Kündigung eines Geschäftsführers wegen Abschlusses eines Scheinvertrages mit einem Kommunalpolitiker
Weiterlesen: Bundesgerichtshof entscheidet über fristlose Kündigung eines Geschäftsführers wegen Abschlusses eines Scheinvertrages mit einem KommunalpolitikerDer für das Gesellschaftsrecht zuständige II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass die zweiwöchige Frist zur Erklärung der fristlosen Kündigung eines Geschäftsführeranstellungsvertrags erst ab positiver Kenntnis des Kündigungsberechtigten vom Kündigungsgrund läuft. Der Kläger war zunächst Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft der Stadtsparkasse Düsseldorf, dann Geschäftsführer der beklagten GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die Tochtergesellschaft ist. Im Jahr 2000…
-
BGH erklärt Ausschlussklauseln der Rechtsschurtzversicherer für unwirksam
Weiterlesen: BGH erklärt Ausschlussklauseln der Rechtsschurtzversicherer für unwirksamDer IV. Zivilsenat des BGH hat entschieden, dass die von zahlreichen Rechtsschutzversicherern in ihren Versicherungsbedingungen verwendete „Effektenklausel“ und die „Prospekthaftungsklausel“ unwirksam sind. Zum Sachverhalt Nach diesen Klauseln gewähren Rechtsschutzversicherer ihren Versicherungsnehmern keinen Rechtsschutz „für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem Zusammenhang mit der Anschaffung oder Veräußerung von Effekten (z. B. Anleihen, Aktien, Investmentanteilen) sowie der Beteiligung…